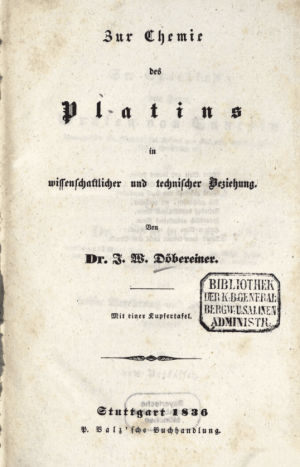»Ich lebe zwischen Weimar und Jena; an beiden Orten habe ich Geschäfte, die mir Freude machen, in Jena kann ich sogar thun und lernen zugleich; die Naturwissenschaft, besonders die Chemie, ist so lebendig, daß man auf angenehme Weise wieder jung wird, indem man seine frühesten Ahndungen, Hoffnungen und Wünsche realisirt findet, und Belege zu dem Höchsten und Besten wozu man sich im Gedanken erheben konnte.« (Goethe an Zelter, 16. Dezember 1817)
Zur Chemie hat Goethe eine besondere Affinität. Deren Fortschritte und Entdeckungen auf praktischem wie theoretischem Gebiet verfolgt er lebenslang mit großem Interesse. In den 80er und 90er Jahren wird Goethe die Bedeutung der Chemie für die Botanik (chemische »Physiologie«), die Mineralogie und die Farbenlehre bewusst. Von den Denkfiguren und experimentalen Anordnungen der zeitgenössischen Chemie weiß er auch literarisch Gebrauch zu machen, wie besonders sein dritter Roman Die Wahlverwandtschaften zeigt. Aber auch institutionell baut Goethe – im Zusammenspiel mit dem Herzog Carl August – die chemische Forschung an der Universität auf und eröffnet ihren Vertretern neue Möglichkeiten.
1789 wird der frühere Mitarbeiter der Hofapotheke in Weimar, Johann Friedrich August Göttling (1755–1809), zum Professor für das Fach Chemie in Jena berufen: die erste eigenständige Professur des Faches in Deutschland. Die Chemie gehörte bis dahin zur medizinischen Fakultät und wurde dort vom Lehrstuhl für praktische Medizin mit vertreten. Die außerordentliche Professur wird in der Philosophischen Fakultät geschaffen. Göttling ist ein »begnadeter Experimentator«, der sich zu Goethes wichtigstem Berater in chemischen Fragen entwickelt. Auch mit dessen Nachfolger arbeitet Goethe überaus fruchtbar zusammen. Auf Betreiben des Herzogs und auf Empfehlung des Münchener Chemikers Adolf Ferdinand Gehlen wird Johann Wolfgang Döbereiner (1780–1849) im Jahr 1810 außerordentlicher Professor der Chemie, Pharmazie und Technologie in Jena. Neben den Vorlesungen und Praktika obliegt ihm auch die Aufsicht über Brauereien und Brennereien des Herzogtums. Döbereiner werden ein Auditorium und ein Laboratorium mit Materialien und Büchern aus Göttlings Nachlass im Alten Schloss bereitgestellt. Im Bericht der herzoglichen Commission im Dezember 1810 spricht Goethe nun erstmalig von einem »chemischen Institut«.
Das anfangs nur dürftig eingerichtete Laboratorium erweist sich schon bald als unzulänglich für Döbereiners Vorhaben. Auch der Blick auf die Gefahren, die mit chemischen Versuchen auf engstem Raum einhergehen, bewegt Goethe dazu, sich für eine Unterbringung Döbereiners im größeren »Hellfeldschen Haus« in der Neugasse einzusetzen. Als im April 1816 die notwendigen Geldmittel zusammenkommen (2250 Rthl), kann das Haus gekauft und von Döbereiner und seiner neunköpfigen Familie bezogen werden. In einem Brief an Friedrich Wilhelm Riemer im Mai desselben Jahres drückt Goethe seine Freude darüber aus:
»Daß ich Döbereiner und somit der Chemie in Jena für ewig eine Burg erbauen kann, giebt mir eine behagliche Thätigkeit. Alle übrige Anstalten die Sie kennen sind in bester Zucht und Ordnung; alle lebendig wenn gleich nicht alle auf gleiche Weise sprossend und wachsend.«
1819 wird ein eigenes Ordinariat für die Chemie in der Philosophischen Fakultät eingerichtet und Döbereiner zum ordentlichen Professor ernannt. Die Chemie sei, so heißt es in einem Schreiben des Herzogs,
»bey dem Umfange, welchen sie durch neuere Entdeckungen und Behandlungs Art bekommen hat […] nicht mehr blos als eine untergeordnete Hülfswissenschaft der Medicin, sondern als ein besonderes Hauptfach der Naturkunde anzusehen.«
Vier Jahre später, im Juli 1823, macht Döbereiner im Hellfeldschen Haus eine bahnbrechende Entdeckung, die er Goethe umgehend mitteilt und die ihm in der Folge europaweite Anerkennung verschafft:
»Ich erlaube mir, Ew. Exzellenz von einer Entdeckung Nachricht zu geben, welche, vom physikalischen und elektrochemischen Gesichtspunkte aus betrachtet, im hohen Grade wichtig erscheint. Ich finde nämlich in einer zusammenhängenden Reihe von Versuchen über das Verhalten einiger Platinpräparate (welche mich bereits zur Entdeckung mehrerer interessanter chemischer Tatsachen geführt haben) gegen verschiedene elastisch-flüssige Substanzen, daß das rein metallische staubförmige Platin die höchst merkwürdige Eigenschaft hat, das Wasserstoffgas durch bloße Berührung und ohne alle Mitwirkung äußerer Potenzen zu bestimmen, dass es sich mit Sauerstoffgas zu Wasser verbindet, wobei eine bis zum Erglühen des Platins gesteigerte Summe von Wärme erzeugt wird.«
Zur Chemie des Platins in wissenschaftlicher und technischer Beziehung (Titelblatt)
Foto: München, Bayerische StaatsbibliothekDöbereiner ist zum Entdecker der Platinkatalyse geworden. Damit liefert er der modernen Katalyse-Forschung, die bis heute eines der wichtigsten Teilgebiete der Chemie darstellt, entscheidende Impulse.
Erstaunlich ist auch die hohe Kunstfertigkeit, mit der Döbereiner seine Entdeckung technisch umzusetzen weiß. Er baut ein Feuerzeug, in dessen Mitte sich eine umgestülpte Glasglocke befindet, in der, befestigt an einem Draht, ein Stück Zink herabhängt. Der umgebende Glaszylinder wird mit einem Schwefelsäuregemisch gefüllt, das mit dem Zink innerhalb der Glocke in Berührung kommt. Dabei kommt es zu einer Reaktion, bei der Wasserstoffgas freigesetzt wird. Da das Gas nicht aus der Glocke entweichen kann, drückt es die Schwefelsäuregemisch nach unten, bis das Zinkstück wieder freiliegt und die Reaktion zum Stillstand kommt. Betätigt man nun das Ventil auf dem Deckel des Feuerzeugs, so strömt der Wasserstoff aus der Glocke auf einen Platinschwamm, der die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zum Glühen und Entflammen bringt. Gleichzeitig sinkt der Gasdruck in der Glocke, die Säure steigt von Neuem zum Zinkstück auf, und der Prozess beginnt von vorn. Döbereiners Apparat reguliert sich damit selbst.
Goethe nutzt das in großer Stückzahl gefertigte und im Handel vertriebene »dynamische Feuerzeug« selbst und würdigt Döbereiners Entdeckung in einem Brief vom 7. Oktober 1826 ausdrücklich:
»Es ist eine höchst angenehme Empfindung, wenn wir eine bedeutende Naturkraft also bald zu irgend einem nützlichen Gebrauch eingeleitet sehen, und so bin ich in dem Falle, mich Ew. Wohlgeboren immer dankbar zu erinnern, da Ihr so glücklich erfundenes Feuerzeug mir täglich zur Hand steht und mir der entdeckte wichtige Versuch von so tatkräftiger Verbindung zweyer Elemente, des schwersten [Platin] und des leichtesten [Wasserstoff] immerfort auf eine wundersame Weise nützlich wird«.
Das Goethe-Laboratorium besitzt einen Nachbau des Originals, der in Sonderführungen gezeigt werden kann. Seine Entdeckung, die macht Döbereiner, wie er 1836 im Rückblick festhält, »zum Eigenthume der Welt, um damit dieser und der Wissenschaft, die er angehört, seine Huldigung darzubringen.«
Link zum Video, das das Funktionieren des Feuerzeugs vor Augen führt:
Das Döbereiner FeuerzeugExterner Link
Literatur:
1. Quellen:
Johann Wolfgang Döbereiner: Neuentdeckte merkwürdige Eigenschaften des Platinsuboxyds, des oxydirten Schwefel-Platins und des metallischen Platinstaubes. In: Journal für Chemie und Physik 38, 1823, 321–326.
Johann Wolfgang Döbereiner: Zur Chemie des Platins in wissenschaftlicher und technischer Beziehung. Stuttgart 1836, hier: 72–77.
Julius Schiff (Hrsg.): Briefwechsel zwischen Goethe und Johann Wolfgang Döbereiner (1810 – 1830). Weimar 1914.
2. Forschungsliteratur (Auswahl):
Hugo Döbling: Die Chemie in Jena zur Goethezeit. Jena 1928, 52–155.
Alwin Mittasch: Döbereiner, Goethe und die Katalyse. Stuttgart 1951.
Dietmar Linke: Johann Wolfgang Döbereiner und sein Beitrag zur Chemie des 19. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Chemie, 21 (1981), 309–319.
Dorothea Kuhn: Goethe und der Chemiker Döbereiner. In: Dies.: Typus und Metamorphose. Goethe-Studien. Hrsg. von Renate Grumach. Marbach am Neckar 1988, 14–17.
Dorothea Kuhn: Goethe und die Chemie. In: ebd. 106–119.
George G. Kauffman: Johann Wolfgang Döbereiner’s Feuerzeug. In: Platinum Metals Review, 43 (1999), 122–128.
Jan Frercks: Die Lehrveranstaltungen der Chemie an der Universität Jena von 1750 bis 1850. In: Thomas Bach (Hrsg.): ‚Gelehrte’ Wissenschaft: das Vorlesungsprogramm der Universität Jena um 1800. Stuttgart 2008, 151–173.
Arno Martin: Von den Anfängen des chemischen Universitätsinstituts in Jena. In: Mitteilungen. Gesellschaft Deutscher Chemiker / Fachgruppe Geschichte der Chemie 22 (2012), 123–132.
Arno Martin: „Daß ich Döbereiner und somit der Chemie in Jena für ewig eine Burg erbauen kann ...“. Goethe, das weimarische Fürstenhaus und die Chemie in Jena. In: Weimar-Jena: Die große Stadt, Bd. 7/1 (2014), 36–51.
Peter Hallpap, Arno Martin: Johann Wolfgang Döbereiner (1780–1849) und das Hellfeldsche Haus in Jena: Jena, 8. September 2016 / GDCh Gesellschaft Deutscher Chemiker, Friedrich-Schiller-Universität Jena 2016.